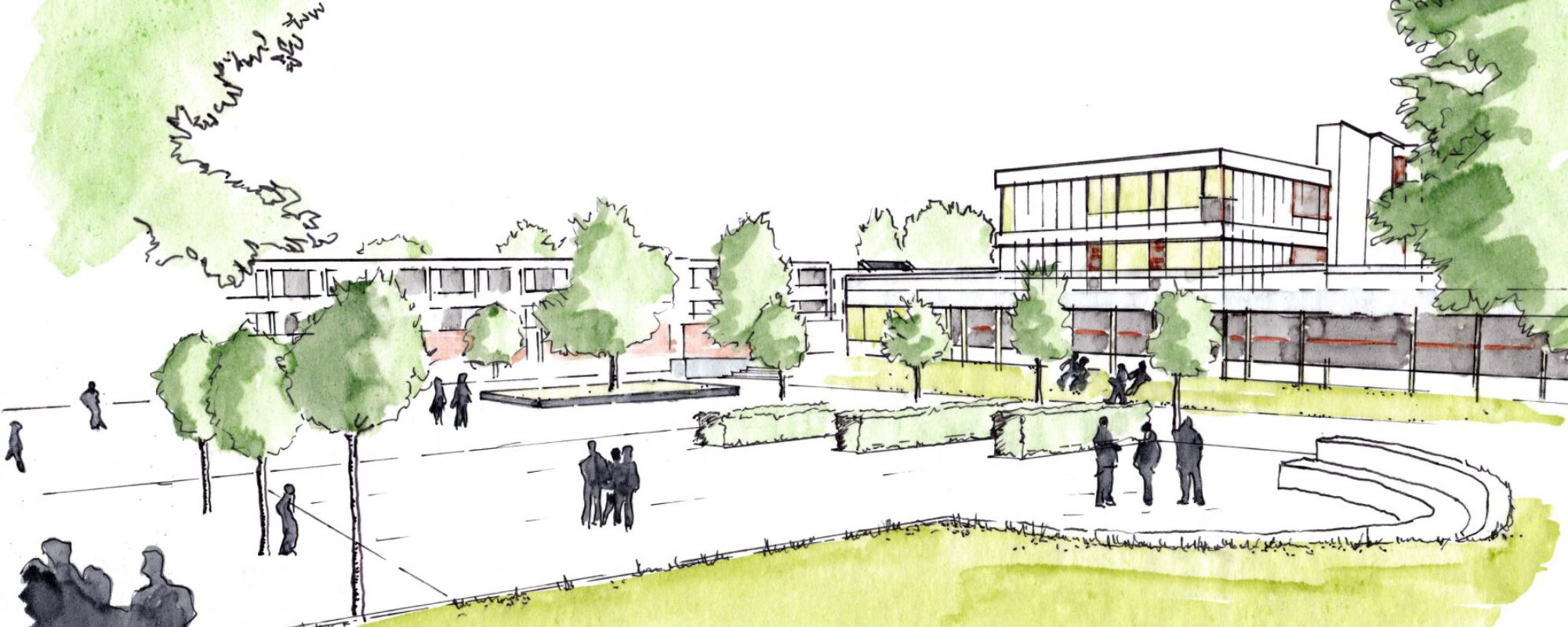Im Rahmen der schulischen Demokratiebildung besuchte die Klassenstufe 9 unserer Schule das ehemalige Konzentrationslager Struthof-Natzweiler in den Vogesen. Schon bei der Ankunft fiel ein irritierender Kontrast auf: Ein strahlend blauer Himmel, warme Sonnenstrahlen, die sich sanft über das Gelände legten – eine beinahe friedliche Atmosphäre, die jedoch in starkem Gegensatz zu dem stand, was dieser Ort symbolisiert und welche Gräueltaten hier einst begangen wurden.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte vor Ort wirkte auf die Schülerinnen und Schüler tiefgreifend und vielschichtig. Die bedrückende Enge der Baracken, die Kälte der Ausstellungsräume, die nüchtern präsentierten Fakten über Deportation, Zwangsarbeit und Ermordung – all dies führte dazu, dass viele Jugendliche sich aus ihrer Komfort- und Wohlfühlzone herausgerissen fühlten.
Die Empfindungen der Schülerinnen und Schüler reichten von Bestürzung über Beklemmung bis hin zu sprachlosem Erschrecken. Viele wussten nicht genau, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollten. Die Atmosphäre am Ort des Geschehens ließ die Geschichte nicht nur greifbar, sondern körperlich spürbar werden. Einige fühlten sich an ihre eigene Geschichte ihrer Familie und Großeltern erinnert, andere blieben still, nachdenklich und für andere war es schier unmöglich, dem Druck der Erzählungen Stand zu halten. So äußerten sich die Schüler und Schülerinnen: „Müssen wir das Herr Schmitt?“ oder „ist das überhaupt etwas für uns?“ Für viele war es ein hochintensiver und emotional geladener Moment, für andere ein andächtiger. Aber was sie eint, es wird Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.
Gerade diese direkte Konfrontation mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte machte den Besuch so bedeutsam. Geschichte wurde nicht nur gelernt, sondern erlebt. Die Reflexion über Demokratie, Menschenrechte und Zivilcourage bekam eine neue, tiefere Dimension.
„Nie wieder“ – dieser oft gehörte Satz bekam in Struthof eine neue Bedeutung. Der Besuch diente nicht nur der Wissensvermittlung, sondern vor allem auch der Erinnerung. Denn nur wer erinnert, kann verhindern, dass sich Geschichte wiederholt. Dies gilt insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten, in der Antisemitismus in unserer Gesellschaft keimt, Desinformationskampagnen gezielt die Geschichte verändern, Populismus salonfähig wird und Nationalstreben innerhalb und außerhalb der EU unsere freiheitliche Demokratie und somit die Grund- und Menschenrechte unserer Gesellschaft gefährden.
In diesem Sinne war der Tag ein wichtiger Beitrag zur schulischen Bildung – außerhalb des Klassenzimmers, aber mitten im Herzen der Demokratieerziehung.
(Matthias Schmitt)